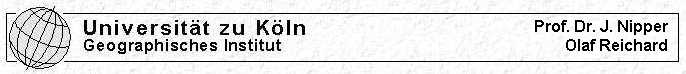 |
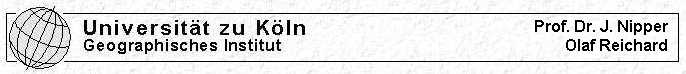 |
| e-mail: reichard@bigfoot.de |
Köln, den 1. März 2001
|
| 5.) Diskussion der Ergebnisse:
Wurde für die Umsiedler genug unternommen? Diese Frage kann selbstverständlich nicht allein durch die vorliegende
Untersuchung beantwortet werden. Die diesbezüglich bisher ergriffenen
Maßnahmen wurden in Kapitel 4.2 der verfassten Examensarbeit (Chronik
der Umsiedlung) kurz dargelegt, sollen aber hier nicht weiter ausgeführt
werden.
Inhalt:
Die neue Wohnsituation
Der von ZLONICKY et al. (1990) als „wesentlich für die Beurteilung des Gelingens einer Umsiedlung“ (s. Kap. 2.1: Sozialverträglichkeit) erachtete Erhalt und Ausbau der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, ist in Inden/Altdorf sicherlich gut verwirklicht, konnte doch festgestellt werden, dass die Versorgungseinrichtungen im neuen Zentrum für die meisten befragten Umsiedler eine Verbesserung darstellen, die generell gute Bewertungen erfahren haben. Soziales Die sozialen Kontakte haben sich für die Umsiedler als Haupt-Motivation, um überhaupt an der Umsiedlung teilzunehmen und einen wesentlichen Faktor für die Akzeptanz für den Neuort herausgestellt. Nun wurde bei WIRTH (1990) konstatiert, dass zwar „40% von 156 befragten Umsiedlern in den Ortschaften Neu-Garzweiler und Neu-Priesterath die Dorfgemeinschaft als Grund für ihre Teilnahme an der geschlossenen Umsiedlung angaben, [sich aber] nur 13% der Nachbarschaften, zumeist zufällig erhalten“ hatten (S. 167). Das wirft die Frage auf, ob der deutlichen Betonung sozialer Aspekte vielleicht mehr „Schein als Sein“ zu Grunde liegt. Doch durch den in dieser Arbeit nachgewiesenen Zusammenhang sozialer Aspekte mit der Akzeptanz, wird diese Frage letztendlich hinfällig: Selbst wenn es in Inden/Altdorf zuträfe, dass sich kaum Nachbarschaften erhalten haben, so wohnten doch alle, die den Erhalt sozialer Bindungen als wichtig erachteten, deutlich lieber in Inden/Altdorf. Zur Pflege und für den Erhalt der sozialen Kontakte wurde auch in Inden/Altdorf einiges unternommen (s. Kap. 4.2 „Chronik“). Dennoch ist bzgl. der Kegelbahnen und des Bürgerhauses die Versorgung sozialer Bedürfnisse nicht optimal verwirklicht. Ob dies die Akzeptanz aller Umsiedler für den Neuort gleichermaßen beeinträchtigt, konnte leider nicht ermittelt werden. Verglichen mit den viel häufigeren Nennungen zur Straßenführung (bzw. zur Ortsplanung), scheinen Defizite im sozialen Bereich allerdings auf den ersten Blick weniger gravierend. Es besteht aber der Einwand, dass die häufigen Nennungen zur Stadtplanung auch auf die den Befragten mitgeteilte Fragestellung zurückzuführen sein könnten. So hieß es auf dem Informationsblatt zur Befragung: „Ob der Schuh gut ist, das weiß der Schuster, ob er bequem sitz, das weiß nur, wer ihn trägt.“ Vielleicht sahen sich die Bewohner dadurch aufgefordert, vorwiegend Mängel im stadtplanerischen Bereich anzugeben. Nichtsdestotrotz sind bzgl. der Orte zur Pflege der sozialen Kontakte, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden, sodass diese bisweilen eine Verschlechterung gegenüber der Situation im Altort darstellen, was in Anbetracht der Bedeutsamkeit dieses Aspektes eher kritisch zu beurteilen ist. Der von ZLONICKY et al. (1990) ausgesprochenen Empfehlung „die soziale Wirkung insbesondere der Gaststätten [...] für die dörfliche Kommunikation auch am neuen Ort sicherzustellen, sei es durch die Verlagerung solcher Betriebe, die aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht als nicht verlagerungswürdig angesehen werden müssen, sei es durch die Einrichtung alternativer Begegnungsmöglichkeiten“ (ZLONICKY et al. (1990), II-S. 271) ist nicht konsequent befolgt worden. Verkehrsführung / Ortsbild / Stadtplanung Zwei weitere Punkte, die nicht optimal gelöst wurden, sind die Straßenführung und, wie vermutet werden kann, das unter Anderem damit verwobene Verhältnis der Umsiedler zur Stadtplanung. Bezüglich der Straßenführung ist anzumerken, dass sie von den Bewohnern Inden/Altdorfs sicherlich besser bewertet worden wäre, wenn eine zweite Zufahrts-Achse schon vorhanden wäre - auch hier hätte also mehr für die Akzeptanz für den Neuort getan werden können. Zur Stadtplanung befürchteten ZLONICKY et al. (1990), dass „die Umsiedler weitgehend fertige Planungen vorfinden werden, in die sich einzupassen von vielen als unangemessene Einschränkung empfunden werden wird.“ (II-S. 230) Dies scheint weniger zuzutreffen, wurde dieser Punkt in den freien Antworten doch ausschließlich von drei Neu-Zugezogenen genannt ("zu viele Bauauflagen"). Lediglich auf die, allerdings unverbindlichen, Angaben aus dem Ideenwettbewerb für regionaltypische Bauformen trifft dies zu. Mit der geringer Nachfrage von Dorftypischen Elementen erklärt sich auch, dass die Antworten zum Ortsbild sehr unterschiedlich ausfielen und die Dorfstruktur nicht einheitlich vermisst wird: Die alte Indener Bevölkerung scheint nicht einheitlich mit solch einer Struktur verbunden zu sein (für die ehemaligen Altdörfer, deren Ort wesentlich kleiner und dörflicher geartet war, soll dieses Urteil nicht lediglich anhand der neun Antwortenden fallen). Dennoch scheint die Umsiedler etwas am Planungsvorgang zu stören: Es konnten Indizien dafür gefunden werden, dass unter den Umsiedlern Aversionen gegen die Stadtplanung (als Vorgang, nicht persönlich) bestehen, im Sinne des Gefühls, eine vorgefertigte Struktur oktroyiert zu bekommen, was seinerseits einen Einfluss auf die Akzeptanz für den Neuort ausübt. Diese passen vielleicht zur These von ZLONICKY et al. (1990) es werde der „Unterschied zwischen dem alten Dorf und dem neuen Ort als Mangel des Neuen“ wahrgenommen (III-S. 102). Worauf diese Aversionen letztendlich beruhen, dazu würde es sicherlich lohnen, eine eigene Untersuchung anzustellen. Denn theoretisch haben die Umsiedler, wie bei kaum einem anderen städteplanerischen Vorhaben, die Möglichkeit Einwände zu äußern, die auch angehört und bearbeitet werden müssen (vgl. Kap 3.2 „Planungsumsetzung“). Eine größere Beteiligungsmöglichkeit wurde jedoch nur in Ausnahmefällen eingefordert, kann also auch nicht Gegenstand der Kritik sein. Wie dieses Gefühl des Übergangenwerdens trotzdem zu Stande kommen könnte, soll folgendes Beispiel verdeutlichen: Im Gespräch mit einem Geschäftstreibenden des Zentrumsbereichs berichtete dieser: „Die Planung war so was von unmöglich, teilweise, also wenn man da nicht zur Selbsthilfe gegriffen hätte... Es hat ja auch keiner von dem Beratungsbüro mit den Geschäftsleuten gesprochen. [...] Die wussten gar nicht über die Situation in Inden bescheid, wie das da läuft [...] Das war geplant am grünen Tisch und war völlig an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei, wenn wir da nicht selber eingegriffen hätten. [...] Es ging dann schon, es musste nur ein Initiator da sein, der die Sache in die Hand nahm.“ Der Schritt, sich deswegen mit den anderen Anwärtern für die Zentrumsgrundstücke zusammenzusetzen und die Bedürfnisse zu formulieren und eine Alternativ-Planung auszuarbeiten, sei also nur unter großem persönlichen Engagement zu Stande gekommen. Jetzt sind nach Auskunft des Betroffenen, die Geschäftstreibenden mit ihrem Zentrum zufrieden. Der gemeinsame Interessensabgleich und ein persönliches Miterleben der Planung, schafft also zweifelsfrei Abhilfe, scheint aber eine große psychologische Hürde darzustellen. Vielleicht waren also die ergriffenen Maßnahmen (Einstellung eines eigenen Stadtplaners, Einrichtung eines städteplanerischen Beratungsbüros, öffentliche Auslegung der Pläne, Diskussion in den Bürgerversammlungen, Wahl eines Umsiedlungsausschusses etc.) immer noch nicht ausreichend, um die Umsiedler dazu zu bewegen, diese Institutionen auch aufzusuchen. Dies stellt zwar eine dem Umsiedler durchaus zumutbare „Belastung“ dar, doch andersherum könnte eine „Einladung zum persönlichen Gespräch“ vielleicht manche Unzufriedenheit beseitigen. Dass dies von Nöten sein könnte, drückt auch das folgende Zitat aus einem Dokumentarbericht des WDR aus, das auf sehr bezeichnende Art und Weise nach dem Verursacherprinzip fragt: „Wer will hier eigentlich was von wem?“ (WDR (2000)). Dass die Einladung zur Dorfversammlung keine gleichwertige Alternative ist, wurde in einem Gespräch wie folgt geschildert: „Da fragt der Eine, wie das denn mit seiner Satellitenschüssel aussieht, der Andere will wissen, was mit seinem Taubenschlag passiert...“. Es ist klar, dass das individuelle Beratung von einer Dorfversammlung nicht bewältigt werden kann, dennoch scheinen sie für einige die erste Anlaufstelle gewesen zu sein. Auch dies könnte durch Einladung zu Einzelgesprächen abgewandt werden. An dieser Stelle ausschließlich die Eigenverantwortung der Umsiedler einzufordern, scheint nicht weiterzuhelfen, wenn „die zielgerechte Vermeidung bzw. Minderung [der] nachteiligen Wirkung [des Braunkohlentagebaus]“ gewünscht ist (s. Kap. 3.2, Aufgaben des Braunkohlenplans). Sicherlich wird es nie möglich sein, auf alle Bedürfnisse eines jeden einem jeden Umsiedlers einzugehen. Aber um Aversionen gegen den Planungsprozess weniger wahrscheinlich zu machen, wäre wichtig, dem Bürger (noch) mehr das Gefühl zu vermitteln, dass seine Meinung gefragt ist und außerdem neue Wege zu schaffen, über die er sich einfacher mitteilen kann. Genaue Vorschläge dazu müssen sicherlich wohlüberlegt sein, an dieser Stelle sollen einige wenige persönliche Ideen als „Denkanstöße“ gegeben werden: - Persönlich adressierte Briefe an alle Umsiedler-Familien, in denen der aktuelle Planungsstand in einem anschaulichen Stadtmodell dargestellt ist. - Einladungen zu einem persönlichen Gespräch mit einem Umsiedlungsbeauftragten / Stadtplaner. - Ortstermine für einzelne Straßenzüge am Neuort, zu denen eingeladen wird, wobei zukünftige Nachbarschaften ihre Bedürfnisse abgleichen können. Die Liste stellt wie gesagt nur eine Zusammenstellung persönlicher Vorstellungen des Autors, nicht die Ergebnisse einer Untersuchung dar. Lage des Zentrums Die in der Literatur oftmals zitierten parteipolitischen Interessen bzgl. der Zentrumslage, sind zwar in Bezug auf den Weg der Entscheidungsfindung zu kritisieren, allerdings scheint das Zentrum an seiner jetzigen Lage, nicht eine „Sackgassenlösung“ darzustellen, wie seinerzeit von den Indener Umsiedlungsausschuss-Mitgliedern befürchtet wurde. Mieter Ein Punkt, der mangels Beteiligung nicht behandelt werden konnte, ist die Frage, ob es Unterschiede in der Bewertung zwischen umgesiedelten Mietern und Eigenheimbesitzern gibt und ob die Bedürfnisse der Mieter erfüllt wurden. Da aber die Bemühungen diesbezüglich sehr umfangreich waren (s. Kap. 4.2: Chronik der Umsiedlung) ist anzunehmen, dass das Schweigen in diesem Fall nicht negativ zu werten ist. Einzelfälle Wie von Zlonicky festgestellt, muss für das umfassende Verständnis von „Sozialverträglichkeit“ mit einbezogen werden, dass die Umsiedlung für einzelne Personen „keinen glücklichen Ausgang nehmen wird“ (s. Kap. 2.1: Sozialverträglichkeit). Dies konnte auch in der vorliegenden Arbeit festgestellt werden und sei durch folgendes Zitat aus einem Fragebogen verdeutlicht: „Rheinbraun hat uns aus unserem schönen alten Ort vertrieben. Beim Verkauf sind wir von diesen Profis übers Ohr gehauen worden. Nach der Umsiedlung hat sich Rheinbraun nicht mehr um uns gekümmert bzw. nachgefragt ob und wie wir diese Umsiedlung überstanden haben. Es hätte noch sehr viel viel mehr für den neuen Ort getan werden müssen, aber alle Politiker, Ortsvertreter etc. waren entweder von Rheinbraun abhängig oder haben zuerst an sich gedacht. Auch die Anliegen der Vereine wurden zwar angehört, wurden aber nicht berücksichtigt, da das Ergebnis schon vor der Befragung feststand. Ich könnte noch soviel Kritik anbringen, aber es lohnt nicht, da sowieso nichts passiert. Auch stehe ich mit dieser Meinung nicht alleine da.“ Hier wird nahezu alles kritisiert, was eine Umsiedlung weniger sozialverträglich macht: Der unwiederbringliche Heimatverlust, die Entschädigungsproblematik, mangelnde Betreuung und Fürsorge für die Umsiedler sowie mangelnde Partizipation, gepaart mit dem Gefühl, dass die eigene Meinung nicht gehört wird. Wie die Überschrift aber unmissverständlich klar macht, handelt es sich hierbei um einen Einzelfall und soll nicht dahingehend missinterpretiert werden, dass dies eine Zusammenfassung des bisher geäußerten darstelle. Quellen: ZLONICKY et al. (1990): ZLONICKY, Peter; DECKER, Jochen; EBERT, Othmar; HATER, Katrin; JANSEN, Thomas; RITSCHERLE, Martin (1990), Teile I bis III: Gutachten zur Beurteilung der Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen im Rheinischen Braunkohlenrevier, drei Teile in einem Band:I: Kernaussagen und EmpfehlungenII: FallstudienIII: FachbeiträgeHrsg.: ILS-Schriften 48, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung NRW, Dortmund (740 S.) WIRTH, Andrea (1990): Bewahrung lokalen Bewußtseins bei Umsiedlungsmaßnahmen im Rheinischen Braunkohlenrevier; in: Berichte zur deutschen Landeskunde, Bd. 64, H.1, Trier (S. 157-173) WDR (2000): Die Story - Unter Strom: Das Dorf, der Konzern und der Markt, Sendung vom 13.3.2000, (21:00 Uhr), die zitierte Person lebt im Umsiedlungsort Otzenrath. Vermerke auf Kap. XY beziehen sich auf die verfasste Examensarbeit Zurück zum Text
|